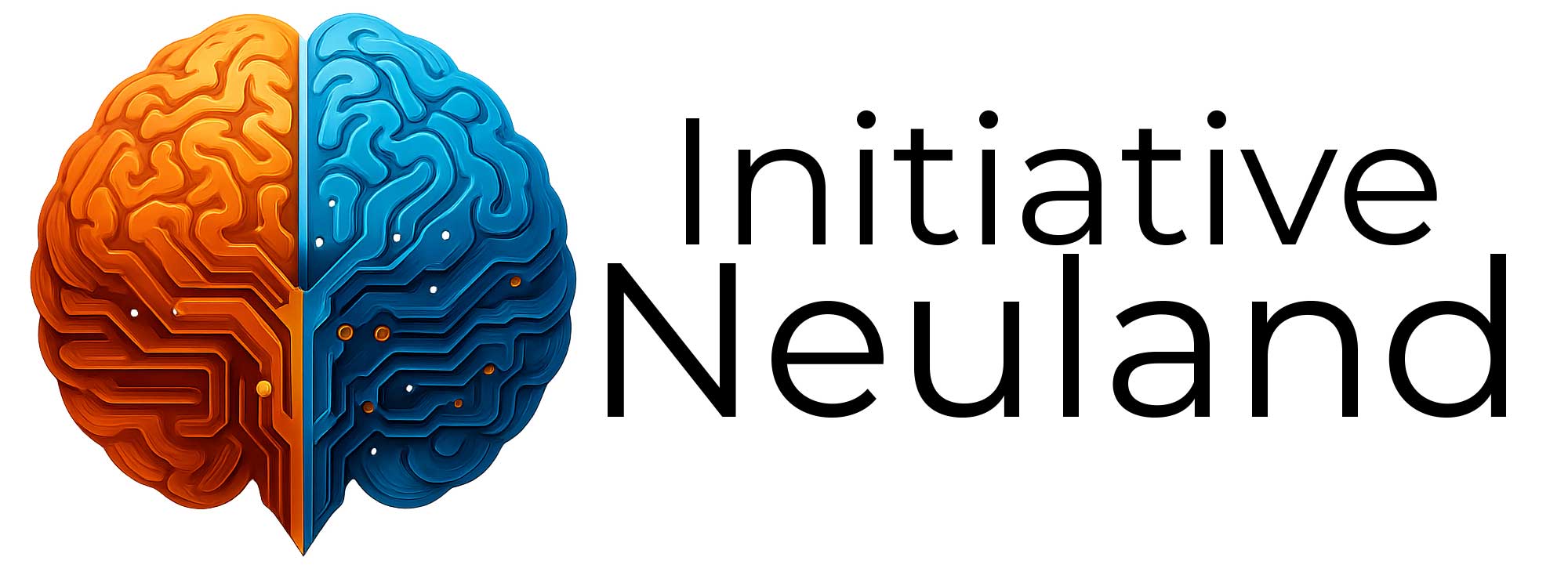Heute möchte ich euch eine der bedeutendsten Errungenschaften der generativen KI vorstellen: Workslop – jene glorreiche Kategorie von KI-Output, die es endlich geschafft hat, das ursprüngliche Versprechen der künstlichen Intelligenz vollständig umzukehren.
Was ist Workslop?
Eine Definition
Der Begriff Workslop (work = Arbeit und slop = Schmodder) stammt aus einer Studie der Harvard Business Review und bezeichnet KI-generierte Inhalte von so herausragender Mittelmäßigkeit, dass sie mehr Arbeitszeit zur Korrektur benötigen, als hätte man das Ganze gleich selbst gemacht. Es ist die Kunst, mit modernster Technologie exakt null Mehrwert zu schaffen.
Man könnte auch sagen: Workslop ist der Beweis, dass die Zukunft bereits da ist, sie will uns nur nicht helfen.
Die geniale Umkehrung des Produktivitätsversprechens
Erinnern wir uns an die goldenen Versprechen: „Effizienz auf einem neuen Level!“
Workslop sagt: „Hold my beer.“
Wir brauchen jetzt so viel Zeit für Überarbeitungen, dass wir die Produktivität nicht verdoppelt haben – wir haben sie quadriert! Nur leider in die falsche Richtung.
Das nenne ich Innovation!
Das Workslop-Paradoxon: Ressourcenverschwendung im Gewand der Effizienz
Besonders faszinierend ist die ökologische Komponente: Für jeden Workslop-generierten Satz werden Serverfarmen bemüht, Energie verbraucht und CO₂ produziert – nur damit am Ende ein Mensch dasitzt und erkennt: „Das hätte ich mit fünf Gehirnzellen besser hinbekommen.“
Es ist, als würde man einen Bulldozer mieten, um ein Sandkorn zu bewegen, und dann feststellen, dass der Bulldozer das Sandkorn in die falsche Richtung geschoben hat. Also holt man eine Schaufel und macht es selbst, nachdem man drei Stunden die Bulldozer-Bedienungsanleitung gelesen hat.
Gibt es ein Gegenmittel?
Ja, aber es klingt langweilig nach… Arbeit:
-> Die “Prompten mit Hirn” – Technik:
Statt „Mach mir mal einen Report“ besser: Kontext, Zielgruppe, Kriterien.
-> Die „Ich-bin-der-Editor“- Technik:
Wer hätte gedacht, dass „kritisch prüfen“ eine nützliche Fähigkeit ist?
-> Die „Iterative-Verbesserung“- Philosophie:
Fast so, als würde man mit einem Werkzeug arbeiten und nicht auf ein Wunder warten.
-> Die radikalste Technik überhaupt:
Manchmal – und jetzt haltet euch fest – ist es schneller, Dinge selbst zu schreiben. Ich weiß, kontrovers. Aber wenn der Prompt länger dauert als der Text selbst, ist vielleicht die Tastatur die bessere KI.
Die versteckten Kosten der Workslop-Ära
Was niemand in die Rechnung einbezieht:
– Die psychische Belastung, generischen nährstofffreien Wortbrei lesen zu müssen.
– Der Verlust des Glaubens an technologischen Fortschritt.
Das große Finale: Warum Workslop eigentlich genial ist
Vielleicht aber ist Workslop die eigentliche Revolution: Eine revolutionäre KI-Innovation, die endlich Arbeit schafft.
In diesem Sinne: Auf die Zukunft, in der wir mehr Zeit mit KI-Korrekturen verbringen als je für die eigentliche Arbeit nötig gewesen wäre.
Hier zum Beitrag auf LinkedIn: Workslop – die KI Innovation als Jobmotor