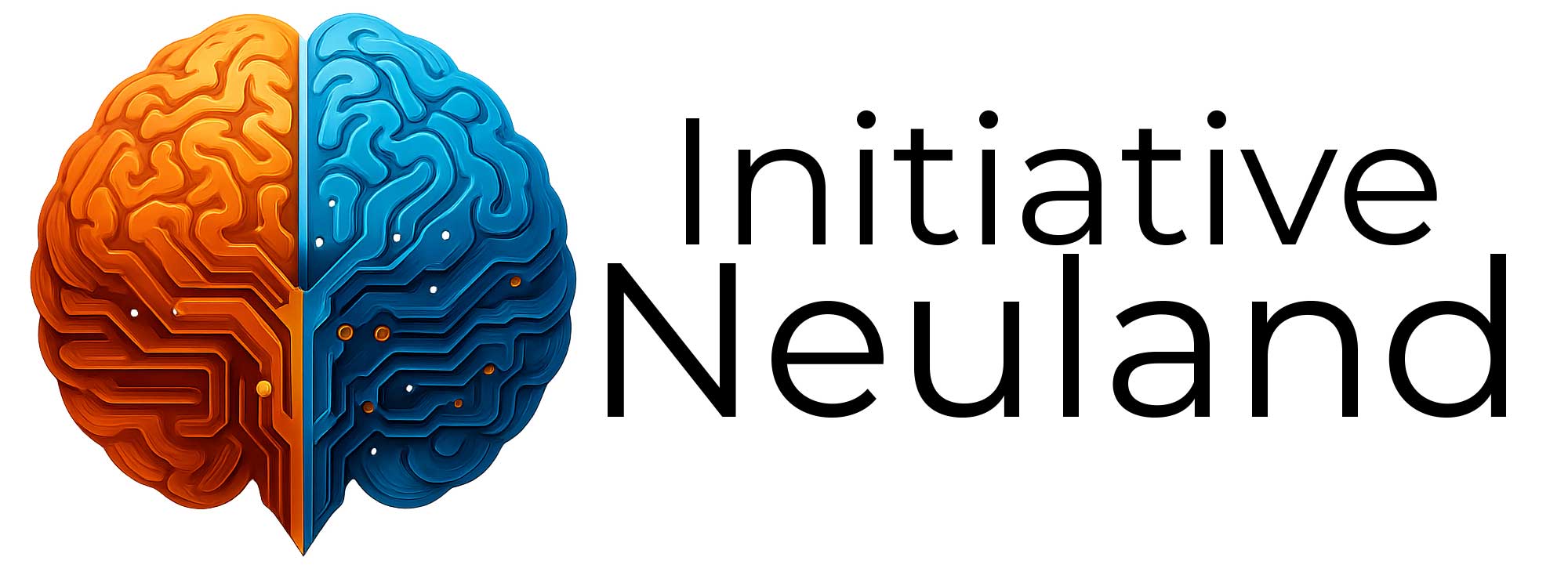Meine KI Assistenten, mit erprobten Prompts als Copy& Paste Vorlagen.
Ich wollte KI eigentlich nicht in mein Privatleben lassen 🤣.
Jetzt ist ChatGPT mein persönlicher Assistent, der mir viel Arbeit abnimmt, wo ich sonst viel Zeit und Nerven lasse: Bürokratie.
🤖 Vertragskündigungen
Rechtssicher kündigen, mit Fristen & Kulanzoption
“Aufgabe: Kündigungsschreiben erstellen
Kontext: Vertrag [Art], Anbieter [Name], Kundennr. [Nummer], Wirksam zum [Datum]
Anforderungen: rechtssicher, höflich-bestimmt, Fristen benennen, Kulanz anfragen (z. B. vorzeitige Beendigung/Gebührenerlass)
Zusätzliche Hinweise: Checkliste mit Anlagen (Kopie Vertrag, Kundennr.), Versandart (Einschreiben?), Unterschrift, Restforderungen, u.a.”
🤖 Mietrecht
Sachlich klären, deeskalieren
“Aufgabe: Anschreiben an Vermieter
Kontext: [Fallbeschreibung], Adresse [..], Belege [Fotos/Zeugen]
Anforderungen: sachlich, lösungsorientiert, Rechte und Pflichten benennen, Vorschlag für einvernehmliche Lösung
Zusätzliche Hinweise: Checkliste mit Belegen, Fristen, u.a.”
🤖 Behördenbriefe entschlüsseln
Amtsdeutsch → Klartext
“Aufgabe: Behördenbrief erklären
Kontext: „[Text des Briefs einfügen]“
Anforderungen: in Alltagssprache zusammenfassen, Fristen und Risiken hervorheben, Optionen und nächste Schritte als Liste ausgeben”
🤖 Versicherungsschäden
Keine Details vergessen: vollständige Schadensmeldung
“Aufgabe: Schadensmeldung erstellen
Kontext: Versicherung [Name], Schaden [Art], Datum/Uhrzeit [..], Ort [..]
Anforderungen: präzise Schilderung (Ursache, Umfang), Kulanzoption ansprechen
Zusätzliche Hinweise: Checkliste mit erforderlichen Unterlagen”
🤖 Verträge verstehen
Klauseln auf Risiken prüfen
“Aufgabe: Vertrag erklären
Kontext: „[Vertragstext einfügen]“
Anforderungen: Kernaussagen pro Klausel, Risiken und Kostenfallen markieren, offene Punkte und Verhandlungsspielräume auflisten”
🤖 Verträge erstellen
Schnell zu einem belastbaren Vertragsentwurf
“Aufgabe: Vertragsentwurf erstellen
Kontext: Vertragsart [Kauf/Miete/Dienst], Parteien [..], Leistungsumfang [..], Vergütung [..]
Anforderungen: neutraler Entwurf mit Platzhaltern, Kulanzklausel einfügen (z. B. außerordentliche Lösung, Ratenzahlung)
Zusätzliche Hinweise: Checkliste, welche Punkte individuell geklärt werden müssen und was ein Anwalt prüfen sollte”
🤖 Reklamationen
Durchsetzungsfähig und fair
“Aufgabe: Reklamationsschreiben erstellen
Kontext: Produkt/Dienst [..], Mangel [..], Kaufdatum/Bestellnr. [..]
Anforderungen: höflich, bestimmt, gewünschte Lösung benennen (Ersatz, Reparatur, Erstattung), Kulanz ansprechen
Zusätzliche Hinweise: Checkliste erforderlichen Unterlagen”
KI ersetzt keine Rechtsberatung. Ich nutze die Entwürfe als Startpunkt, die finale Verantwortung bleibt bei mir.
Zum Beitrag auf LinkedIn: KI Assistenten, mit erprobten Prompts als Copy& Paste Vorlagen