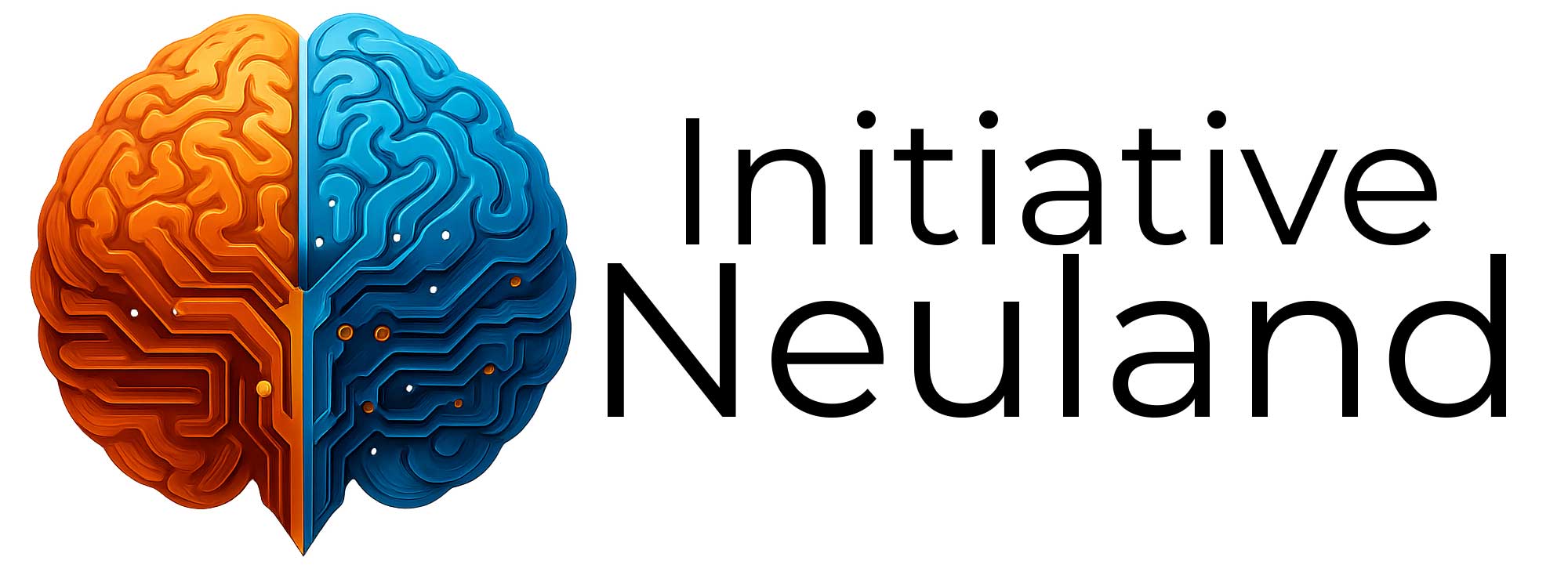Automation ersetzt keine Strategie. Auch nicht mit KI.
Der Einsatz generativer KI verführt zu operativer Effizienz und kaschiert dabei häufig das Fehlen einer klaren strategischen Zielsetzung. Prozesse werden automatisiert, Content generiert, Entscheidungen getroffen. Was dabei oft fehlt, ist die konzeptionelle Einordnung:
Warum wird automatisiert?
Mit welchem Ziel?
Für welchen Wirkungskontext?
KI ersetzt keine Zielklärung, kein Geschäftsmodell, keine kohärente Customer Journey. Wer ein Sprachmodell einführt, ohne die strukturelle Passung zu prüfen, riskiert funktionale Redundanzen, widersprüchliche Kommunikationsabläufe und unklare Verantwortlichkeiten im operativen Prozess.
Prompt Engineering ohne Use Case ist kein Fortschritt, sondern technisch vermittelte Beliebigkeit.
Es ist erschreckend, wie häufig zentrale Grundsätze des Projektmanagements im KI-Kontext suspendiert werden. Anforderungsanalyse, Zieldefinition, Stakeholder-Mapping oder der Aufbau einer sauberen Zielhierarchie – bewährte Methoden zur Projektsicherung – scheinen plötzlich verzichtbar, sobald ein KI-Tool involviert ist.
Doch genau diese Grundlagen sind unverzichtbar, um KI-gestützte Vorhaben wirkungsorientiert, verantwortbar und nicht zuletzt auch skalierbar zu gestalten.
Effizienz entsteht nicht durch Tool-Nutzung, sondern durch die intelligente Kopplung von Systemen, Datenflüssen und Entscheidungslogiken. Automatisierung ist keine Antwort, sondern eine Methode!
Strategisches KI-Design beginnt daher wie jedes Projekt ohne KI mit funktionaler Analyse, nicht mit Feature-Demonstration. Es integriert technologische Möglichkeiten in eine übergeordnete Logik: Was lässt sich durch KI anders, besser oder neu denken und zwar jenseits bloßer Beschleunigung?
Die zentrale Kompetenz liegt nicht im Tool-Verständnis, sondern in der Fähigkeit, Kontexte zu differenzieren, Prozessziele zu definieren, Schnittstellen zu gestalten. Nur wenn diese Grundlagen geklärt sind, erzeugt man mit generative KI mehr als synthetische Output-Kaskaden.
Andernfalls entwickeln wir nur Effizienz darin, das Falsche zu tun.
So schützt du deinen KI-Output vor Confirmation Bias.
Neulich bekam ich eine DM, die mich kurz sprachlos gemacht hat. Eine Art Persönlichkeitsanalyse, die jemand mit ChatGPT auf Basis meines Posts erstellt hat.
Ergebnis: eine Diagnose meiner „freudschen Selbstschutz-Taktiken“, detailliert und aburteilend (Kurzfassung, die Langfassung im Download unten):
– Ich inszeniere mich als Retterin der Tiefe.
– Ich kritisiere Performance, will aber selbst performen.
– Ich bin rhetorisch virtuos, aber nur auf den mir genehmen Tasten.
– Wer nicht klingt wie ich, ist raus.
𝐖𝐚𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐡𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫𝐭?
Die Erklärung steckt im Prompt, mit dem das Ergebnis generiert wurde:
„Analysiere diesen Text nach verborgenen Mustern Freud’scher Selbstschutz-Taktiken der Selbstlüge.“
Wer so Promptet darf sich nicht über Confirmation Bias wundern! Denn das Ergebnis wäre – egal welcher Text analysiert worden wäre – immer ähnlich ausgefallen.
𝐖𝐚𝐫𝐮𝐦?
Die KI wurde angewiesen, nach „verborgenen Mustern Freud’scher Selbstschutz-Taktiken der Selbstlüge“ zu suchen. Wenn man KI mit einem solchen Auftrag losschickt wird sie etwas finden, und wenn nicht, wird sie sich etwas zusammenhalluzinieren. Sie hat gar keine andere Wahl, denn der Prompt gibt einen klaren Auftrag ohne andere Möglichkeiten aufzuzeigen.
Wenn ich mit KI eine solche Analyse durchführen möchte muss ich den Prompt offen formulieren. Wie man das macht findest du Download unten.
𝐖𝐢𝐞 𝐤𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐢𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐦𝐞𝐢𝐝𝐞𝐧?
Tipps findest du im Prompt Guide zur Vermeidung von Confirmation Bias (Download unten)
Einige wichtige Punkte in der Kurzfassung:
1. Hinterfrage deine Fragestellung
Jeder Prompt setzt einen Deutungsrahmen.
Wenn du nach verstecktem Selbstbetrug fragst, wird GPT genau nur danach dort suchen – selbst wenn nichts darauf hindeutet.
Tipp: Stelle keine Suggestivfragen. Lass Raum für Mehrdeutigkeit.
2. Erkenne deine eigene Intention
Oft liefern KI-Modelle nicht „die Wahrheit“, sondern die Antwort, die du ihnen durch den Prompt nahegelegt hast.
Tipp: Reflektiere, ob dein Prompt auf Bestätigung statt auf Erkenntnis zielt.
3. Die Projektion liegt im Prompt, nicht im Modell
KI ist kein objektiver Beobachter, sondern sie verarbeitet, was du vorgibst.
Wer Bestätigung erwartet, bekommt sie. Wer Zweifel zulässt, bekommt Perspektiven.
Tipp: Vermeide moralisch oder psychologisch geladene Begriffe im Prompt.
4. Formuliere offen, nicht eng
Ein Beispiel:
🛑 „Analysiere diesen Text nach freudschen Selbstlügen.“
✅ „Welche unterschiedlichen Lesarten sind bei diesem Text denkbar – auch im Hinblick auf mögliche Selbstschutzmechanismen?“
Tipp: Lass Interpretationsspielräume zu und fordere Alternativen aktiv ein.
Methoden, Insights & Prompt Guide
Solche Aussagen hast du sicher schon mehrfach auf LinkedIn gelesen. Die gängigen Anleitungen klingen ungefähr so: Standard-Prompt in ChatGPT werfen und fünf Posts auf dem Silbertablett erhalten. Korrekturlesen? Geschenkt. Das Custom-GPT weiß ja, was es tut:
✅ Offene Halbsätze zwingen zum „Mehr anzeigen“ -> FOMO Hook und Cliffhanger am Zeilenende
✅ Kurz hält die kognitive Last niedrig -> 8-10 Wörter pro Satz
✅ 1 Satz = 1 Absatz (Whitespace pumpt die Dwell Time)
✅ Fachbegriffe raus (simple Wörter pushen die Verständlichkeit um 30%)
✅ Leseniveau 7–9. Klasse -> Flesch Reading Ease ≥ 60
✅ egal wenn die erfunden sind, checkt eh keiner -> Konkrete Zahlen statt „deutlich“, „stark“
Das Ergebnis: perfekter Algorithmus-Futterbrei. Standardisiert durchoptimiert, gut durchgekaut.
Aber ist das noch Inhalt, oder nur noch Output?
Ich wünsche mir, dass solche Formate öfter im Feed stummgeschaltet werden. Nicht, um irgendwen zu strafen, sondern um ein Zeichen zu setzen: Qualität entscheidet. Und diese Entscheidung können wir nicht dem Algorithmus überlassen.
𝐀𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐥𝐮𝐬𝐬 𝐦𝐢𝐭 𝐌𝐞𝐜𝐤𝐞𝐫𝐧, her mit Lösungen.
Ich zeige hier, wie ich meine Posts mit Hilfe von KI erstelle. Nicht aus der arroganten Annahme heraus, dass ich es besser mache sondern um zu zeigen, dass und wie es auch anders geht:
FÜR KI
GEGEN Contentmüll.
𝐖𝐢𝐞 𝐥ä𝐬𝐬𝐭 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐊𝐈 𝐟ü𝐫 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐞𝐢𝐧𝐬𝐞𝐭𝐳𝐞𝐧?
Heute teile ich meine Erfahrungen aus Deep Research Projekten für unterschiedliche Bereiche von Finanzdienstleistung über Marketing bis Journalismus. Ich habe daraus einen kompletten Leitfaden erstellt, den ihr euch unten herunterladen könnt.
Mein Leitfaden basiert auf einer zweistufigen Herangehensweise, die sich in der Praxis bewährt hat, um strukturierte, tiefgehende und belastbare Ergebnisse zu erzielen:
1. Meta-Prompt als methodischer Rahmen
Statt direkt ins Thema einzusteigen, wird zunächst ein strukturierter Prompt für die nachfolgende Recherche generiert mithilfe eines Meta-Prompts.
Dieser umfasst:
– Zielsetzung & Stakeholder
– Fragestellung(en)
– relevante Datenquellen
– Datentypen (qualitativ / quantitativ)
– Analyseperspektiven
– Validierungsschritte
– Ausgabeformate
𝐃𝐞𝐫 𝐕𝐨𝐫𝐭𝐞𝐢𝐥: Der Meta-Prompt verhindert vorschnelle Vereinfachungen, reduziert Bias, schafft Klarheit über die Zielrichtung und sorgt so für eine systematische Tiefenbohrung, statt bloßer Themenabarbeitung.
2. Contrarian Prompte zur Validierung
Das Ergebnis wird nicht einfach übernommen, sondern gezielt hinterfragt.
Dazu kommen Contrarian Prompts zum Einsatz: eine wirkungsvolle Technik, um blinde Flecken und implizite Annahmen im Ergebnis kritisch sichtbar zu machen:
– Was wäre ein gutes Argument gegen diese These?
– Warum könnte die gängige Sichtweise irreführend sein?
– Wie sähe das Gegenteil aus und wo hätte es vielleicht sogar Berechtigung?
Diese Gegenfragen helfen, die Konsistenz und Tiefe der Rechercheergebnisse zu prüfen, gerade in komplexen oder normativ aufgeladenen Themenfeldern.
📥 𝐃𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐥𝐬𝐭ä𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐋𝐞𝐢𝐭𝐟𝐚𝐝𝐞𝐧?
Schreibe mir eine Nachricht
User Stories sind das Herzstück agiler Entwicklung: prägnante Beschreibungen, die Anforderungen klar und verständlich formulieren. Doch nach meiner Erfahrung gehen in der Praxis Details oft verloren, Missverständnisse entstehen und wertvolle Zeit wird in endlose Klärungen investiert.
Ich zeige dir hier (PDF unten), wie du mit Chat GPT User Stories nicht nur formulieren, sondern direkt in KI-gestützte Workflows übersetzen kannst: Meine Custom GPTs machen aus User Stories nicht nur Textfragmente, sondern verlässliche, umsetzbare Anforderungen.
Die Vorteile dieser Vorgehensweise:
✓ Automatisierte Präzision: Deine User Story wird zu einer klaren, verständlichen Beschreibung ohne Lücken oder Interpretationsspielräume.
✓ Vertieftes Verständnis: Die KI stellt gezielte Rückfragen und deckt fehlende Details auf, um Anforderungen umfassend abzubilden.
✓ Dynamische Akzeptanzkriterien: Anstatt abstrakte Ziele zu diskutieren, formuliert die KI klare Bedingungen, die automatisch überprüft werden.
✓ Skalierbare Lösungsansätze: Aus der User Story wird eine Problemstellung und die KI liefert direkt kreative und praxistaugliche Lösungen.
✓ Simuliertes Nutzerfeedback: Realitätsnahe Tests durch die KI sorgen für fundierte Optimierungen bevor echte Nutzer einbezogen werden.
Durch meinen Workflow mit Custom GPTs bleiben deine User Stories nicht im Theoretischen stecken. Sie werden zu präzisen, verständlichen und sofort umsetzbaren Vorgaben.
👉 Möchtest du wissen, wie du das konkret umsetzt? In meinem Leitfaden „User Stories mit KI“ zeige ich dir, wie. Hier geht´s zu meinem Leitfaden Agilität + KI: User Stories
In 6 Schritten zur Automatisierung
Viele Unternehmen experimentieren mit KI aber nur wenige integrieren sie so, dass wirklich Zeit gespart, Qualität gesichert und Teams entlastet werden.
💡 Aber wie wird aus punktueller KI-Nutzung ein sinnvoller, automatisierter Marketingprozess?
In meinem Cheat Sheet, das ihr euch unten downloaden könnt zeige ich die 6 entscheidenden Schritte, um KI nicht nur punktuell zu nutzen, sondern systematisch in Marketingprozesse zu integrieren:
[1] Relevante Anwendungsfelder identifizieren und priorisieren
Wo stecken die größten Zeitfresser? Inhalte, Recherche, Newsletter?
Wer hier ansetzt, gewinnt sofort an Effizienz.
[2] Toollandschaft strategisch aufbauen
Einzeltools bringen wenig, die Kombination macht den Unterschied: von ChatGPT bis n8n, eingebettet in bestehende Systeme wie Notion oder CMS.
[3] Prozesse sichtbar machen
Erst wenn klar ist, wer was wann macht, lässt sich gezielt automatisieren. Visualisierung ist der Schlüssel.
[4] Prompts & Workflows standardisieren
Erfolgreiche Prompts sollten nicht im Kopf bleiben, sondern als Templates und Custom GPTs wiederverwendbar sein, inklusive Review-Gate.
[5] Iterativ optimieren & Review-Gate
Nicht alles auf einmal, kleine Iterationen, klares Feedback und kontinuierliche Verbesserung schaffen echten Fortschritt.
+ 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐆𝐚𝐭𝐞: Automatisch generierte Inhalte sollten immer durch ein manuelles oder teilautomatisiertes QA-Gate laufen für Stil, Fakten, Ton und rechtliche Aspekte. Dies kann auch durch ein spezialisiertes Custom GPT unterstützt werden.
[6] Governance & Datenschutz klären
KI braucht Rahmenbedingungen: Datenschutz, Rollenklarheit und Transparenz über KI-generierte Inhalte sind Pflicht.
Hier geht´s zu meinem Cheet Sheet: KI-Integration in Marketing-Workflows
Denn Prompting ist nicht das Hacken eines Automaten, sondern das Trainieren einer neuen Sprach- und Denkweise. Eine, die gleichzeitig analytisch und kreativ sein muss.
Es ist erstaunlich, wie hartnäckig sich das Missverständnis hält, Prompting sei nur ein „Trick“, um KI-Systeme auszutricksen.
Ein bisschen clever formulieren, ein bisschen auf die richtigen Keywords achten und fertig ist der magische Output? Diese Herangehensweise stößt schnell an die Grenze. Genau an die Grenze, hinter der hochwertige Ergebnisse liegen.
Gutes Prompting ist echte, dialogische Kompetenz: das strukturierte, präzise, empathische Kommunizieren mit einem komplexen System:
Du musst wissen, was Du willst und es auf eine Weise formulieren, die sowohl menschlich nachvollziehbar als auch für die KI interpretierbar ist.
Du musst kontextualisieren und antizipieren, wie eine KI reagiert.
Du musst systematisch optimieren, messen und iterieren.
Prompt Optimization wird zur Schlüsselkompetenz
Der neue Leitfaden von OpenAI unterstreicht diese Entwicklung:
Statt „einfach ein bisschen besser fragen“ geht es jetzt darum, systematisch
• Kontext und Zielsetzung zu präzisieren
• explizite Anweisungen zu geben
• Antworten iterativ zu verbessern und Modelle zu steuern statt sich von ihnen überraschen zu lassen.
Mit anderen Worten: Gutes Prompting ist eine strategische Kommunikationsdisziplin und die besten Ergebnisse entstehen nicht durch spontane Kreativität, sondern durch methodisches Optimieren.
In meinen Beratungen arbeite ich bewusst nicht mit „Prompt-Rezepten“, sondern zeige, wie sich individuelles Prompting als strategisches Werkzeug nutzen lässt:
Für bessere Prozesse, innovativere Ergebnisse und Teams, die souverän mit generativer KI umgehen.
Lass uns aufhören, Prompting zu unterschätzen. Es verdient denselben Respekt und Aufmerksamkeit wie jede andere echte fachliche Kompetenz.
👉 Deshalb habe ich einen umfassenden Prompting-Leitfaden entwickelt: praxisorientiert und methodisch.
Meine Mission:
Dich nicht mit Best Practices von gestern abspeisen, sondern dir das Denken, Testen und Optimieren beibringen, das du wirklich brauchst, um KI sinnvoll und erfolgreich einzusetzen.
Wenn Du lernen willst, wie du:
• präzisere Prompts entwickelst,
• systematisch testest,
• bessere Ergebnisse kontrollierst,
Design Thinking bedeutet in der Praxis aufwendige Workshops mit bunten Zetteln, großen Ideen und oft der Frust beim Transfer in den Alltag.
Aber was, wenn du diesen Prozess systematisch mit KI abbilden könntest: Schritt für Schritt, prompt für prompt?
👉 Genau das geht. Und zwar ziemlich gut.
Ich habe die Phasen des Design Thinking in Custom GPTs übersetzt:
Nutzerbedürfnisse erkennen durch simulierte Interviews oder Analyse echter Rezensionen
• Ideen generieren: kreativ UND strukturiert
• Prototypen bauen: erstmal textbasiert, dafür schnell
• Hypothetisches Feedback einholen bevor Du live gehst
• Lernen & optimieren: iterativ, wie es sein sollte
Es ist nicht kompliziert. Sondern klar, nachvollziehbar und sofort nutzbar – nutzerzentrierte Innovation auf KI-Basis.
Und es funktioniert nicht nur für Produkte. Sondern auch für Prozesse, Strategien, u.v.m.
Und wenn Du tiefer einsteigen willst buche meinen Kurs „Design Thinking mit KI“
… und sie verändert, wie wir mit KI arbeiten:
Dein Name? Deine Tonalität? Was Dir wichtig ist?
ChatGPT merkt sich das jetzt dauerhaft.
Doch Achtung: Das Gedächtnis ist kein Automatismus. Es braucht Führung, denn die KI wird nicht durch Rechenleistung besser, sondern durch gute Kommunikation, Kontext und klare Anleitung.
Was bedeutet das konkret?
Statt Dich bei jedem neuen Chat zu wiederholen, kannst Du jetzt einmal sauber definieren, wie Du arbeitest, kommunizierst und denkst und ChatGPT lernt mit.
Das verändert sich im Detail:
– Mehr Konsistenz in Deinen Ergebnissen
– Schnellere Antworten mit weniger Korrekturschleifen
– Persönlichere Empfehlungen und Formulierungen
– Bessere Zusammenarbeit auf langfristige Aufgaben
Aber nur wer das Gedächtnis aktiv führt, profitiert wirklich. Denn Du musst entscheiden, was gespeichert wird und was wieder vergessen werden soll.
Meine Tipps für den Einstieg:
👉 Memory aktivieren (in den Einstellungen)
👉 Klare Wissensanker setzen – z. B. Wer bin ich, wie spreche ich, was sind meine Ziele?
👉 Feedback geben: „So bitte nicht mehr“, „Das war genau richtig“. So lernt die KI wie ein neuer Mitarbeiter
👉 Regelmäßig überprüfen, ob das, was gespeichert ist, noch aktuell oder sinnvoll ist
Das Ziel: Eine KI, die Dich kennt. Nicht als spooky Überwachung sondern als echte hilfreiche Assistenz.
ChatGPT bietet mit „Projekte“ eine Möglichkeit, Aufgaben zu strukturieren und KI-basierte Workflows effizient umzusetzen. Parallel dazu stehen die Custom GPTs zur Verfügung.
Aber: Wo liegt der Unterschied in der Anwendung? Was passt besser zu Deinem Vorhaben?
Der Unterschied:
Custom GPTs
sind eigenständige „Instanzen“ von GPT, die Du mit Persönlichkeit, Fachwissen und Regeln ausstattest. Für erweiterte Funktionalitäten kannst Du externe Tools integrieren. Du trainierst sie, gibst ihnen ein Gedächtnis und kannst sie auch anderen zugänglich machen.
Sie eignen sich perfekt für:
• wiederkehrende Aufgaben mit gleichbleibendem Ton (Dein virtueller Assistent)
• Rollen wie Coach, Redakteur, Übersetzer, Ideengeber
• öffentlich oder intern zugängliche Tools mit individueller Note
Projekte
hingegen sind eine Art Arbeitsumgebung innerhalb ChatGPT, ideal für komplexere Aufgaben mit mehreren Bestandteilen: Du kannst hier alles sammeln, was zum Projekt gehört: Dateiuploads, Verlauf, Anweisungen. Alles ist an einem Ort.
Sie eignen sich perfekt für:
• Content-Produktionen mit Korrekturschleifen
• explorative Aufgaben (Recherche, Entwürfe, Ideenfindung)
• Workspaces, in denen man sich iterativ vorarbeitet
Anwendungsbeispiele:
Projekte
Du willst eine neue Landingpage inkl. Social-Copy, FAQs und Value Proposition erstellen.
Statt alles in einem Chat zu verlieren, legst Du ein Projekt an, gliederst Deine Aufgaben und arbeitest mit Versionen – alles bleibt sauber, nachvollziehbar und wiederholbar.
Custom GPT
Du baust für Dein Team einen „Content-Coach“:
Ein Custom GPT, das alle Guidelines kennt, in eurer Sprache antwortet, und immer bereit ist, Headlines, Captions oder Redaktionspläne zu erstellen – auch für Kollegen ohne KI-Vorerfahrung.
So entscheidest Du konkret wann ein Projekt und wann ein Custom GPT passt:
[1] Ziel definieren: Brauchst Du eine dauerhafte Rolle (->Custom GPT) oder einen temporären Arbeitsraum (->Projekt)?
[2] Teste Deinen Use Case: Mach 2–3 Aufgaben in beiden Formaten. Du wirst schnell merken, was besser funktioniert.
[3] Kombinieren erlaubt: Du kannst Custom GPTs auch mit Projekte kombinieren z. B. zur Qualitätssicherung oder zur Textvariation.
Nicht jedes Problem braucht ein Custom GPT. Und nicht jedes Briefing passt in ein Projekt. Aber mit der richtigen Einschätzung am Anfang (analysiere Deine Anforderungen!) kannst Du aus beiden das Maximum herausholen.
Welche Erfahrungen hast Du mit Projekten und Custom GPTs? Stimmst Du meinen Einordnungen zu oder gibt es Ergänzungen?