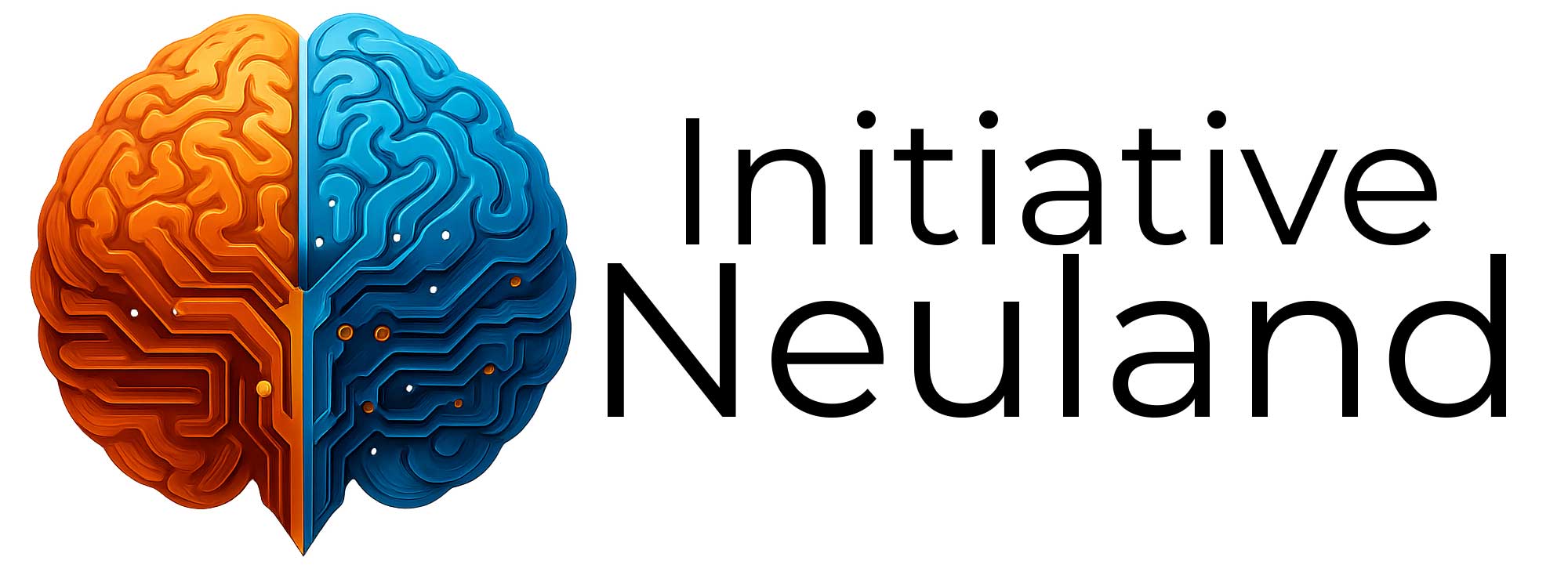KI Modelle generieren Code, der funktioniert und beeindruckend präzise Antworten. Sie trainieren sich gegenseitig, korrigieren sich selbst, entwickeln Fähigkeiten, die kein Mensch eingeplant hat.
Und wir?
Alle wollen Agenten. Autonome Systeme, die Tickets lösen, Angebote schreiben, Prozesse orchestrieren. Der Traum von der Maschine, die mitdenkt.
Aber in denselben Unternehmen weiß niemand, wer überhaupt prompten darf. Schulungen? Verschoben. Datenqualität? Später.
Das ist keine KI-Strategie. Das ist Leadership ohne Konzept.
KI-Transformation ist Change Management und Change scheitert hier nicht an der Technologie, sondern an dem, was niemand anfassen will.
0 + 100 ≠ 100.
Man kann das leistungsfähigste Modell der Welt kaufen. Wenn es auf Chaos trifft, produziert es schnelleres Chaos. KI erfindet keine Substanz, sondern entlarvt, wo keine ist.
Nur redet darüber niemand gern. Der Engpass ist nicht die Technologie, er sitzt in Meetings und wartet auf Freigaben, in der Hoffnung, dass irgendwer anders das schon regelt.
Was es braucht, ist kein größeres Modell. Es sind kürzere Schleifen, klarere Leitplanken. Mitarbeitende und Vorgesetzte, die verstehen, was sie da eigentlich bedienen.
Das klingt weniger nach Zukunft als „autonome Agenten“. Es taugt auch nicht gut für Keynotes, aber sehr gut für Leadership.
Es ist der Unterschied zwischen digitaler Transformation und Pilotprojekten, die leise scheitern.
Die Frage ist daher nicht: Wann kommt unser Agent?
Sondern: Was passiert, wenn er sieht, was wir ihm geben?
Genau deshalb sind KI Kompetenz Schulungen keine Nice-to-have-Maßnahme:
Was mir in Unternehmen begegnet sind Mitarbeitende, die KI irgendwie nutzen, weil sie an einer 2-stündigen “KI Kompetenzschulung” teilgenommen haben und danach alleine gelassen werden.
Wenn Du KI Kompetenz aufbauen möchtest hier die nächsten Termine für KI Kompetenz Schulungen der Initiative Neuland:
Grundlagen Generative KI und Prompting (2 Vormittage): 20./21.01.2026 & 18./19.02.2026
Fortgeschrittene Anwendung generative KI (2 Vormittage): 08./09.01. & 26./27.02.2026
Individuelle Termine Online & Inhouse auf Anfrage.
Weitere Infos auf der Webseite